Die Planung für das Kompetenzzentrum Leichte Sprache und Gebärdensprache stößt auf Kritik bei der Deutschen Gehörlosen-Jugend (DGJ) und dem Deutschen Gehörlosen-Bund (DGB). Der Jugendverband DGJ veröffentlichte am 11. Juli 2025 eine Stellungnahme, in der die Errichtung des Kompetenzzentrum grundsätzlich erstmal begrüßt wird: „Ein solches Zentrum kann langfristig dazu beitragen, Barrieren abzubauen und Zugänge zu verbessern“, heißt es. „Es soll Standards setzen und Empfehlungen für die Praxis entwickeln.“
Bei den Berliner Inklusionstagen im Mai 2025 wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) angekündigt, dass die Leitung im achtköpfigen Kompetenzzentrum von einer hörenden Person übernommen wird. Die DGJ sieht darin einen Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention und dem Leitspruch „Nichts über uns ohne uns“. Es sei zwingend notwendig, dass Taube Menschen an dem Zentrum federführend beteiligt sind.
Ohne ihre Mitbestimmung droht das Zentrum ein paternalistisches Projekt zu bleiben – gut gemeint, aber ohne echte Teilhabe und damit weder gerecht noch zukunftsfähig.
Ferner sieht die Jugendorganisation die Verbindung von Deutscher Gebärdensprache (DGS) und Leichter Sprache kritisch, da es sich bei der DGS im Gegensatz zur Leichten Sprache um eine eigenständige Sprache mit dazugehöriger Kultur handle, wohingegen die Leichte Sprache eine vereinfachte Form der Deutschen Sprache sei.
Die DGJ fordert „mit Nachdruck“, dass das Kompetenzzentrum unter Leitung Tauber oder Taubblinder Menschen stehen muss. Auch müsse sofort die Beteiligung und Beratung Betroffener eingeholt werden.
Das Zentrum darf nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg strukturiert und besetzt werden.
Am 17. Juli meldete sich auch der Deutsche Gehörlosen-Bund zu Wort mit einer Stellungnahme. Neben den bereits genannten Punkten der DGJ kritisiert der Dachverband, dass die Ziele und Aufgabenstellung unklar seien. Er sieht auch die Ansiedlung beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales problematisch, dem die fachliche Expertise und die „Perspektive der Kultur und der Lebenswelt“ von Tauben Menschen abgehe. Unterm Strich führt der DGB in der Stellungnahme vor allem das Thema „Nichts über uns ohne uns“ aus und bringt sich selbst als „Trägerstruktur“ ins Spiel anstelle eines Ministeriums. Spannend ist die Forderung, eine Vermittlungsplattform für Gebärdensprachdolmetschende einzurichten, die „bedarfsgerecht an Bundesbehörden“ vermittelt werden, ohne aber konkrete Fallbeispiele oder Problematiken abseits des sowieso herrschenden Dolmetschmangels zu nennen.
Wir haben beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales nachgefragt, als die DGB-Stellungnahme noch nicht vorlag, aber da es sich um eine sehr allgemeine Antwort handelt, kann sie auch ohne Weiteres auf die DGB-Stellungnahme bezogen werden. Konkret hatten wir zur DGJ-Stellungnahme u.a. gefragt, ob es stimmt, dass die Leitungsposition von einer hörenden Person besetzt wird, und ob zumindest die anderen acht Stellen von Tauben Personen besetzt werden. Außerdem fragten wir das BMAS:
Wie sehen Sie die Kritik, dass eine Besetzung mit hörenden Personen ein Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention wäre?
Das BMAS antwortete, dass zur Besetzung und zum Stellenumfang noch keine Angaben gemacht werden können. Die Errichtung des Kompetenzzentrums sei Bestandteil der Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes, das sich zur Zeit in der Ressortabstimmung befindet.
Wie sehen Sie den Punkt, dass die Felder Leichte Sprache und Gebärdensprache zusammengelegt werden? Die DGJ kritisiert, dass es sich dabei eigentlich um zwei gänzlich verschiedene Zielgruppen und Bedürfnisse selbiger handele.
Die Auffassung würde das BMAS nicht teilen, heißt es in der Antwort. „Insbesondere“, so das Ministerium, ist es nicht der Meinung, „dass es nicht zu einer Vermischung der Bereiche kommen dürfe“.
Das BMAS ist überzeugt, dass es innerhalb einer Einrichtung angemessen und ohne „Qualitätsverlust“ möglich ist, zu beiden Sprachbereichen zu beraten und dabei die jeweils einschlägigen Besonderheiten und Bedürfnisse zu beachten.
Zusätzlich schildert das BMAS auch den Aufgabenbereich des Kompetenzzentrums: „Das Bundeskompetenzzentrum soll Ministerien des Bundes und ihre nachgeordneten Einrichtungen vor dem Hintergrund ihrer Verpflichtungen zur barrierefreien Kommunikation insbesondere durch Verwendung von Gebärdensprache und Leichter Sprache aus dem Behindertengleichstellungsgesetz heraus beraten und unterstützen.“
Zusammenfassend ist zur Personalstruktur des Bundeskompetenzzentrums noch nichts entschieden, und an der Zusammenlegung von Leichter Sprache und Gebärdensprache hält das BMAS offenbar fest.


















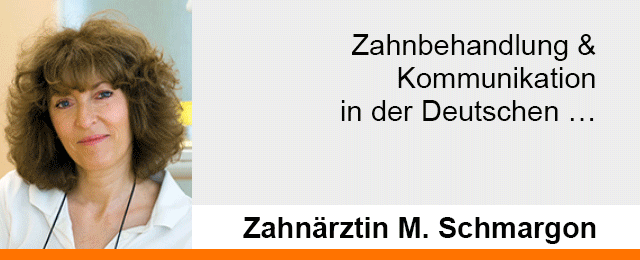




1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
Wer kommt bloß auf solche Ideen?
Man stelle sich vor, man gründet ein Bundeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit. Klingt erstmal gut. Und dann kommt jemand auf die Idee: Warum nicht eine vollwertige natürliche Sprache – wie Türkisch, Chinesisch oder die Deutsche Gebärdensprache – mit einer sprachlichen Variante des Deutschen, der „Leichten Sprache“, zusammenbringen?
Was bitte schön hat das eine mit dem anderen zu tun? Nichts. Der einzige gemeinsame Nenner: „Behinderung“. Und so landen völlig verschiedene Konzepte – eine Sprache mit Grammatik, Kultur und Geschichte wie die DGS einerseits und eine vereinfachte Sprachvariante wie Leichte Sprache andererseits – im selben Topf.
Das Ergebnis? Die Semantik verschiebt sich. Wenn Leichte Sprache als Hilfsmittel für „Menschen mit kognitiven Einschränkungen“ gilt und DGS daneben gestellt wird, überträgt sich dieser Bedeutungsrahmen. Plötzlich erscheint Gebärdensprache nicht mehr als vollwertige Sprache, sondern als „Tool“ für Menschen mit Defiziten. Das ist keine Inklusion – das ist eine subtile Form der Abwertung.
Wenn man schon ein Kompetenzzentrum gründet, dann bitte mit Klarheit: Leichte Deutsche Sprache und Leichte Deutsche Gebärdensprache – das würde Sinn ergeben. Jeweils für hörende und gehörlose Menschen mit kognitiven Einschränkungen.
Aber es gibt Menschen, die gehen weiter. Sie schlagen eine „gebärdensprachorientierte Leichte Sprache Plus“ (SEL+) vor – und testen diese sogar hinter dem Rücken der Community und Teilnehmenden in der Großen Dolmetscherumfrage 2022. In einer Veröffentlichung von 2022 heißt es, SEL+ sei sehr gut verstanden worden. Aha. Nur: Die Dissertation, auf der das basieren soll, ist bis heute nicht öffentlich zugänglich. Transparenz sieht anders aus.
Und ehrlich gesagt: Glaubwürdig ist es ohnehin nicht. SEL+ produziert absurde Satzfragmente wie „warm an meiner Seite“. So kann man DGS nicht übersetzen. Das ist kulturelle Aneignung, nicht Barrierefreiheit.
Und weil es noch nicht absurd genug ist: Ausgerechnet Personen, die solche Konzepte vertreten, sind auch noch Sachverständige der Bundesregierung in der Bundesinitiative Barrierefreiheit – mit direktem Einfluss auf die Ausgestaltung des neuen Kompetenzzentrums. Wer genau dazugehört, erfahren wir nicht. Die Liste der Sachverständigen bleibt „aus Datenschutzgründen“ geheim.
Was bedeutet das praktisch? Ganz einfach: DGS-Videos sparen.
Wenn SEL+ angeblich verstanden wird – wozu noch teure Übersetzungen in Deutsche Gebärdensprache bezahlen? Und wenn sich das Ganze dann noch in ein KI-Tool gießen lässt – voilà, das Problem ist „gelöst“. Billig, effizient, angeblich barrierefrei.
Die Frage bleibt: Versteht Ihr es wirklich nicht – oder wollt Ihr es nicht verstehen?