Das Deutsche Institut für Menschenrechte drängt den Bund zu verstärkten Bemühungen bei der Umsetzung inklusiver Bildung. Laut Susann Kroworsch, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Instituts, sollte der Bund angesichts der Tatsache, dass immer noch mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Jahr 2023 an Förderschulen unterrichtet werden und nur wenige Bundesländer ein inklusives Schulsystem aufbauen, seine Verantwortung stärker wahrnehmen. Dies wurde anlässlich der Veröffentlichung der Analyse „Inklusive Schulbildung – Warum Bund und Länder gemeinsam Verantwortung übernehmen sollten“ betont.
Die Analyse zeigt, dass vielen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Deutschland der diskriminierungsfreie Zugang zu einem inklusiven Schulsystem de facto verwehrt wird. Der Anteil derjenigen, die an Förderschulen unterrichtet werden, bleibt bundesweit seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau, und Prognosen deuten darauf hin, dass sich dies bis 2030/2031 nicht verbessern wird. Darüber hinaus variiert der Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Förderschulen unterrichtet werden, erheblich zwischen den Bundesländern. Die Umsetzung der inklusiven Bildungsentwicklung ist also in ganz Deutschland uneinheitlich, und die mangelnde Umsetzung in vielen Bundesländern steht im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention. Für Kinder und Jugendliche bedeutet der Besuch einer Förderschule oft den Beginn einer lebenslangen Kette der Ausgrenzung, da viele von ihnen danach in spezielle Ausbildungsformen wechseln, die ihre Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verringern.
Die Analyse betont, dass die Verwirklichung eines inklusiven Bildungssystems ohne eine nachhaltige Gesamtstrategie nicht zu erwarten ist. Kroworsch betont, dass der Bund seine menschenrechtliche Verpflichtung, die er durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention übernommen hat, erfüllen muss. Die Bundesregierung kann ihre Verantwortung nicht ablehnen, indem sie auf die Bildungshoheit der Länder verweist. Das Institut schlägt daher Maßnahmen zur Stärkung eines kooperativen Föderalismus vor, um die Verpflichtungen gemäß Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Hierzu gehören Verfassungsänderungen sowie ein Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern, ein „Pakt für Inklusion“.












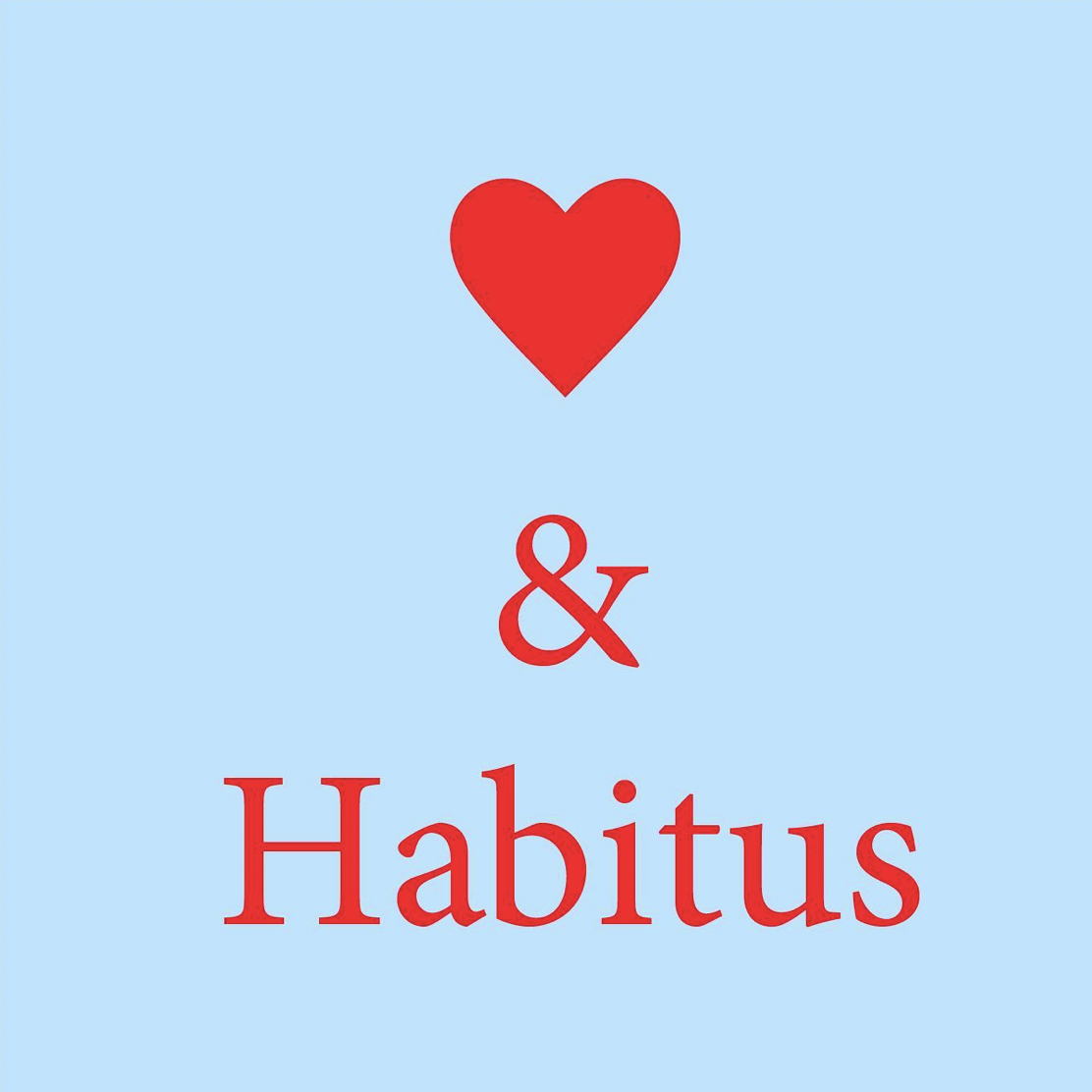



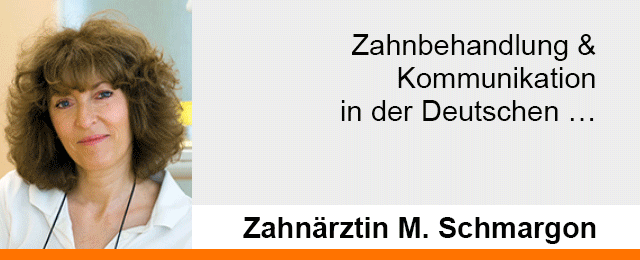



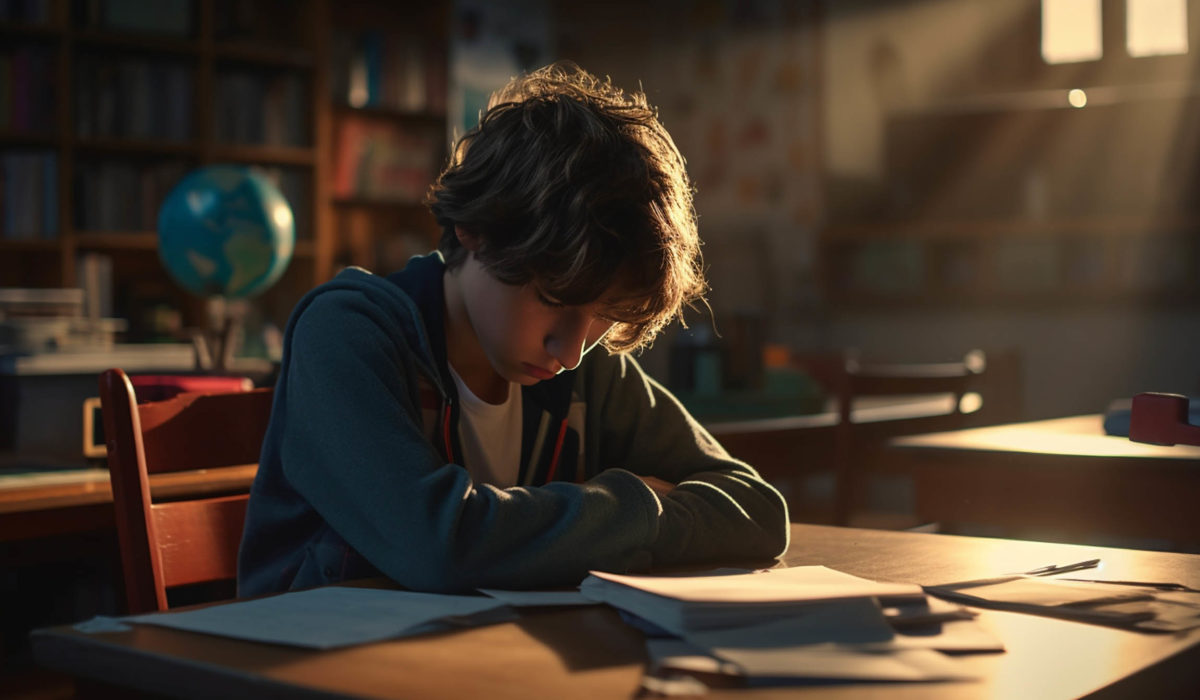


1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
Ich bin angehender Lehrer (Gymasiales Lehramt) und lerne gerade DGS, denn ich denke es ist extrem wichtig eine Gebärdensprache sprechen zu können, und ich hoffe damit einen Beitrag zu Inklusion leisten zu können.
Das wird mir an der Uni ziemlich schwer gemacht. Die RWTH Aachen hat derzeit keine Gebärdenkurse, da nachdem der letzte Dozent in Ruhestand gegangen ist, nur eine schlechtere Stelle ausgeschrieben wurde, und sich zu den Bedingungen niemand findet.
Also habe ich meinen ersten Kurs Online belegen müssen (da vhs mir zu teuer ist), an einer anderen Uni, mit extrakosten verbunden.
Mir ist klar, dass ich da nur der Tropfen auf den heißen Stein bin, und das ganze System sich anpassen muss, aber selbst auf dieser Individuellen Ebene werden mir so viele Hürden wie möglich in den Weg gelegt.